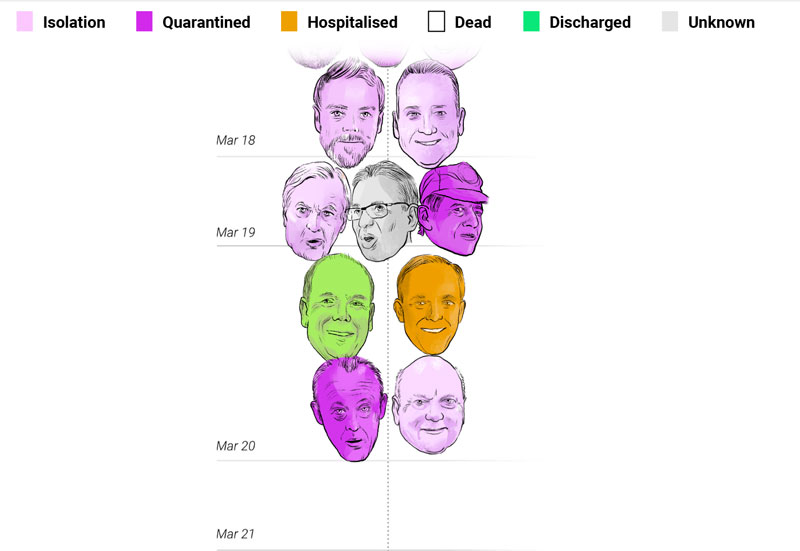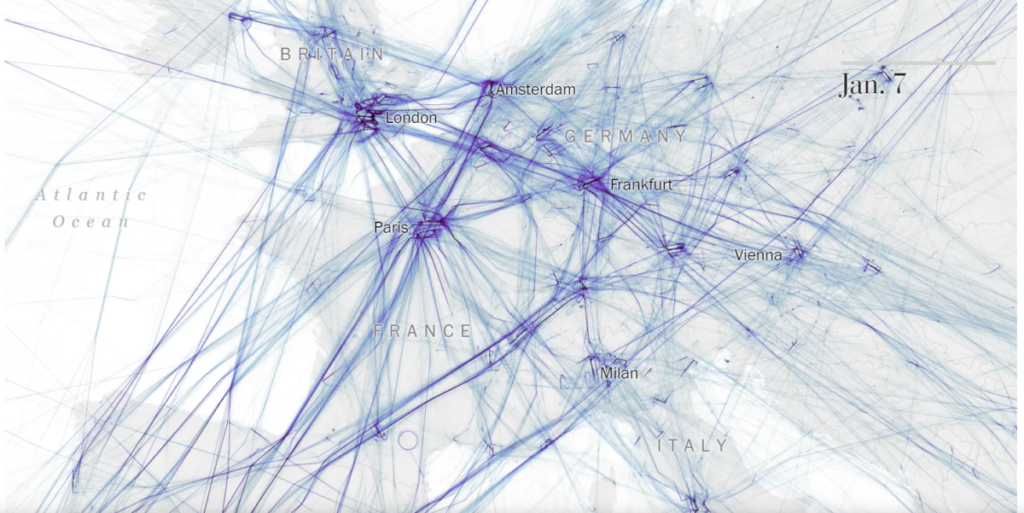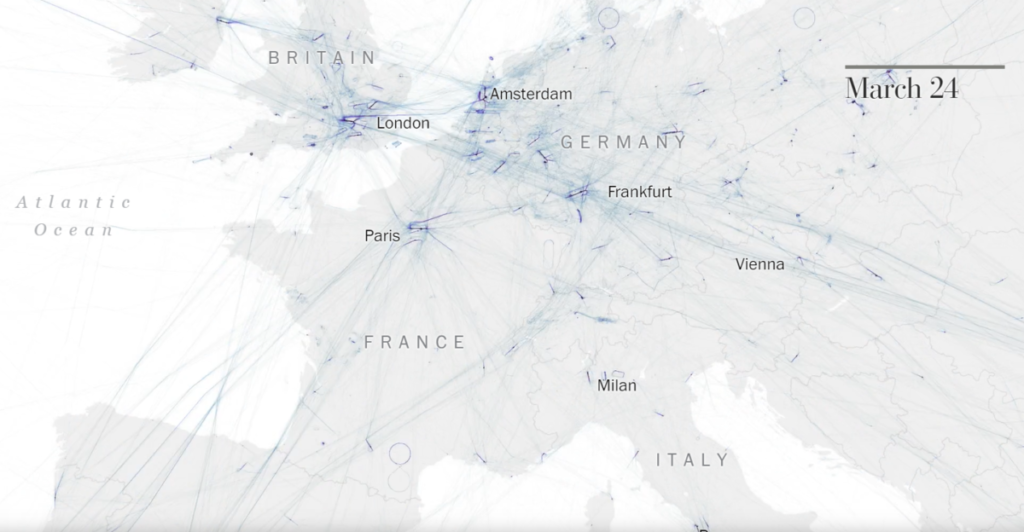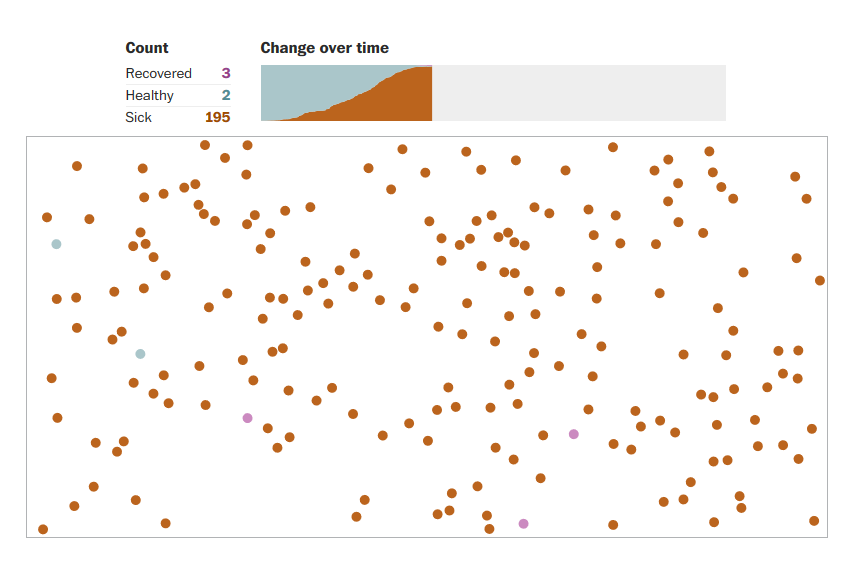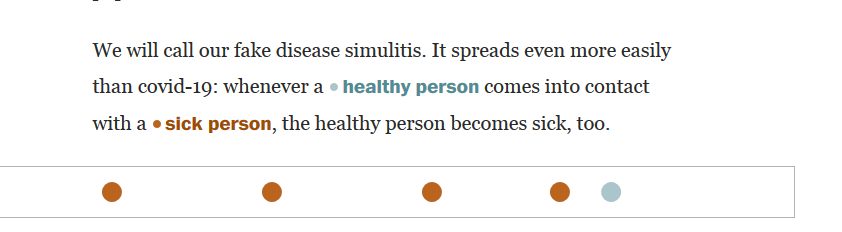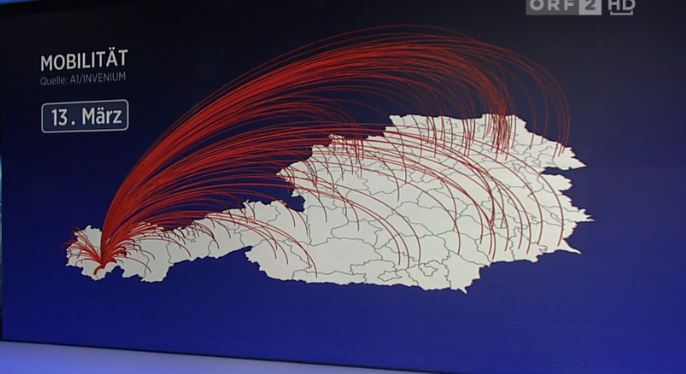In vielen EU-Ländern ist ein hohes Bruttoinlandsprodukt auch mit einem hohen CO₂-Ausstoß verbunden. Einzelne Beispiele zeigen allerdings, dass das nicht unbedingt so sein muss.
In der Europäischen Union gibt es viele Länder, die sowohl ein hohes BIP als auch einen hohen CO₂-Ausstoß haben. Einzelbeispiele heben sich jedoch stark von diesem Muster ab.
Die folgende Grafik (Daten: Stand 2017) zeigt die einzelnen BIP-pro-Kopf-Werte pro EU-Mitgliedstaat. Den höchsten Wert hat hier Luxemburg. Das Großherzogtum hat gleichzeitig auch den höchsten CO₂-Ausstoß der EU.
Der kleine, große Umweltsünder
Das flächenmäßig zweitkleinste EU-Land ist also Spitzenreiter beim CO₂-Ausstoß. Ein wichtiger Faktor für die hohen Pro-Kopf-Emissionen Luxemburgs ist der sogenannte Tanktourismus: Viele Deutsche fahren aufgrund günstiger Benzinpreise zum Tanken in ihr Nachbarland. Jene Emissionen, die von den Fahrzeugen ausländischer Tanktouristen im Land verursacht werden, fließen in die CO₂-Statistik mit ein. Bei einem derart kleinen Land ändert das viel an den Gesamtzahlen.
Allerdings sind auch die Luxemburger selbst maßgeblich an ihren Schadstoffemissionen beteiligt. Das Land hat den höchsten Motorisierungsgrad Europas, also gibt es am meisten Autos im Verhältnis zu den Einwohnern: Pro 1.000 Einwohner gibt es ungefähr 662 Fahrzeuge.
Das weiß auch die Regierung des Großherzogtums. Um dem hohen CO₂-Ausstoß entgegenzuwirken, sind deshalb seit Anfang März dieses Jahres alle öffentlichen Verkehrsmittel für Einheimische kostenlos. Die dabei entstehenden Kosten will die wirtschaftsliberale Regierung über Steuergeld decken.
Die Ausreißer
Einen direkten Zusammenhang zwischen BIP pro Kopf und dem CO₂-Ausstoß pro Kopf lässt sich nicht eindeutig ableiten. Zwar haben reiche Länder einen tendenziell höheren CO₂-Ausstoß, jedoch fallen auch ärmere Länder wie Estland, Bulgarien, Tschechien und Polen durch hohe Emissionszahlen auf.
Die Kombination hohes BIP und geringe CO₂-Emissionen wünschen sich wohl die meisten Regierungen Europas. In der folgenden Karte sind alle EU-Länder nach den Eigenschaften BIP pro Kopf und CO₂-Ausstoß pro Kopf gerankt. Hell eingezeichnete Länder haben ein relativ hohes BIP und niedrige CO₂-Emissionen. Dunkel eingezeichnete Staaten haben ein niedriges BIP, aber hohe CO₂-Emissionen.
Eine farbliche Aufschlüsselung und die genaue Berechnungen der Karte gibt es hier.
Das Positivbeispiel dieser Auflistung ist Schweden. Das Königreich ist (am BIP gemessen) eines der reichsten Länder der Europäischen Union. Trotzdem schafft es das Königreich, die niedrigsten CO₂-Emissionen zu haben. Weitere Länder, die die beiden Eigenschaften ebenfalls einigermaßen erfolgreich kombinieren sind Malta, Frankreich, Dänemark und Italien.
Im Fall von Estland ist es beinahe umgekehrt: Die Republik ist mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (pro Kopf) im untersten Drittel des EU-Rankings. Gleichzeitig belegt sie in der Emissions-Reihung den zweiten Platz hinter Luxemburg. Polen, Tschechien, Bulgarien, Zypern und Griechenland schneiden im BIP-CO₂-Vergleich ebenfalls schlecht ab.
Österreich liegt beim BIP pro Kopf auf Platz sechs, bei den CO₂-Emissionen im Mittelfeld, was insgesamt den sechsten Platz in diesem Ranking ergibt.
Das Universal-Vorbild
Schweden wird immer wieder als Vorbild für politische Maßnahmen gesehen. Auch beim Thema CO₂ ist das Königreich Vorreiter. Ein Grund für die EU-weit niedrigsten Emissionen ist die CO₂-Steuer, die das Land bereits im Jahr 1991 eingeführt hat. Schwedens CO₂-Steuer ist nicht nur fast 30 Jahre alt, sondern auch die höchste in Europa: Eine Tonne CO₂ wird im Königreich mit 115 Euro besteuert. Die Wirtschaft des Landes ist seither trotzdem um 78 Prozent gewachsen.
Um eine insgesamt zu große Steuerlast zu vermeiden, wurden mit der Einführung der CO₂-Steuer gleichzeitig die Lohnsteuer gesenkt sowie Erbschafts- und Vermögenssteuern abgeschafft. Zudem hat die schwedische Bevölkerung Steuern gegenüber ohnehin keine allzu große Skepsis, sie ist einen starken Staat gewohnt. Des weiteren gibt es in dem Land keine starke Lobby gegen Klima-Maßnahmen, da es weder Gas- noch Kohlevorkommen gibt.
Für Firmen, die stark im internationalen Wettbewerb stehen – wie beispielsweise im Flugverkehr, der Schifffahrt oder der Stahlindustrie – gibt es Ausnahmen von der CO₂-Steuer. Diese bringen den Unternehmen Steuererleichterungen bis zu 60 Prozent. Für diese Rabatte wird das nördliche Königreich immer wieder kritisiert.
Baltisches Sorgenkind
Niedriges BIP, hoher CO₂-Ausstoß. Estland schafft es, diese beiden Eigenschaften zu verbinden. Im Jahr 2017 verlieh der Klimaschutz-Index von Germanwatch dem Land als einziges in der EU die Klimagesamtnote “sehr schlecht”. Zwischen 2009 und 2014 ist der Anteil an erneuerbaren Energiequellen an der Primärversorgung sogar gesunken. Estland ist außerdem laut seinem Umweltminister die “kohlenstoff-intensivste Volkswirtschaft aller OECD-Länder”.
Grund für die fatale Klimabilanz ist der estnische Bodenschatz: In der Republik liegt ein Fünftel des europäischen Ölschiefervorkommens. Im Sedimentgestein Ölschiefer ist Bitumen enthalten, eine Vorstufe von Erdöl. Ölschiefer ist außerdem die klimaschädlichste Methode, um an fossile Brennstoffe zu kommen. Bei seiner Verbrennung gelangt laut einem OECD-Bericht mehr CO₂ in die Atmosphäre, als bei jedem anderen Primärbrennstoff. Die Reste des Gesteins, die bei der Verbrennung übrig bleiben, verschmutzen zudem das Grundwasser.
Durch die Ölschiefer-Methode werden mehr als 90 Prozent des Stroms in Estland produziert und es hängen Tausende Arbeitsplätze an dieser Industrie. Dieses Verfahren macht Estland außerdem zum größten Stromproduzenten des Baltikums.
Die folgende Grafik zeigt, aus welchen Sektoren die Emissionen der Einzelbeispiele kommen:
Gemeinsame Ziele
Die Europäische Union und andere Staaten haben sich immer wieder Ziele gesetzt, um die Erderwärmung einzudämmen.
Beim Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 haben sich insgesamt 195 Länder auf folgendes geeinigt:
- den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen
- das Ziel, den Anstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, da dies die Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich vermindern würde
Über die genaue Bedeutung des Begriffs “vorindustriell” herrscht keine Klarheit. Laut NASA ist die weltweite Durchschnittstemperatur jedenfalls seit dem Jahr 1880 um 1,14 Grad Celsius angestiegen (Stand 2019).
Der neueste europäische Vorstoß ist die Ankündigung des Green New Deals von EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen. Dessen Ziel ist es, als Europäische Union bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden.
Im aktuellen Regierungsprogramm der türkis-grünen Bundesregierung in Österreich ist das gleiche Ziel mit dem Jahr 2040 datiert.
Grafiken & Text: Paul Maier, Ronny Taferner, Sandra Schober Titelbild: Markus Spiske Datenquellen: Eurostat (CO2 Emissionen), EEA, Eurostat (BIP)